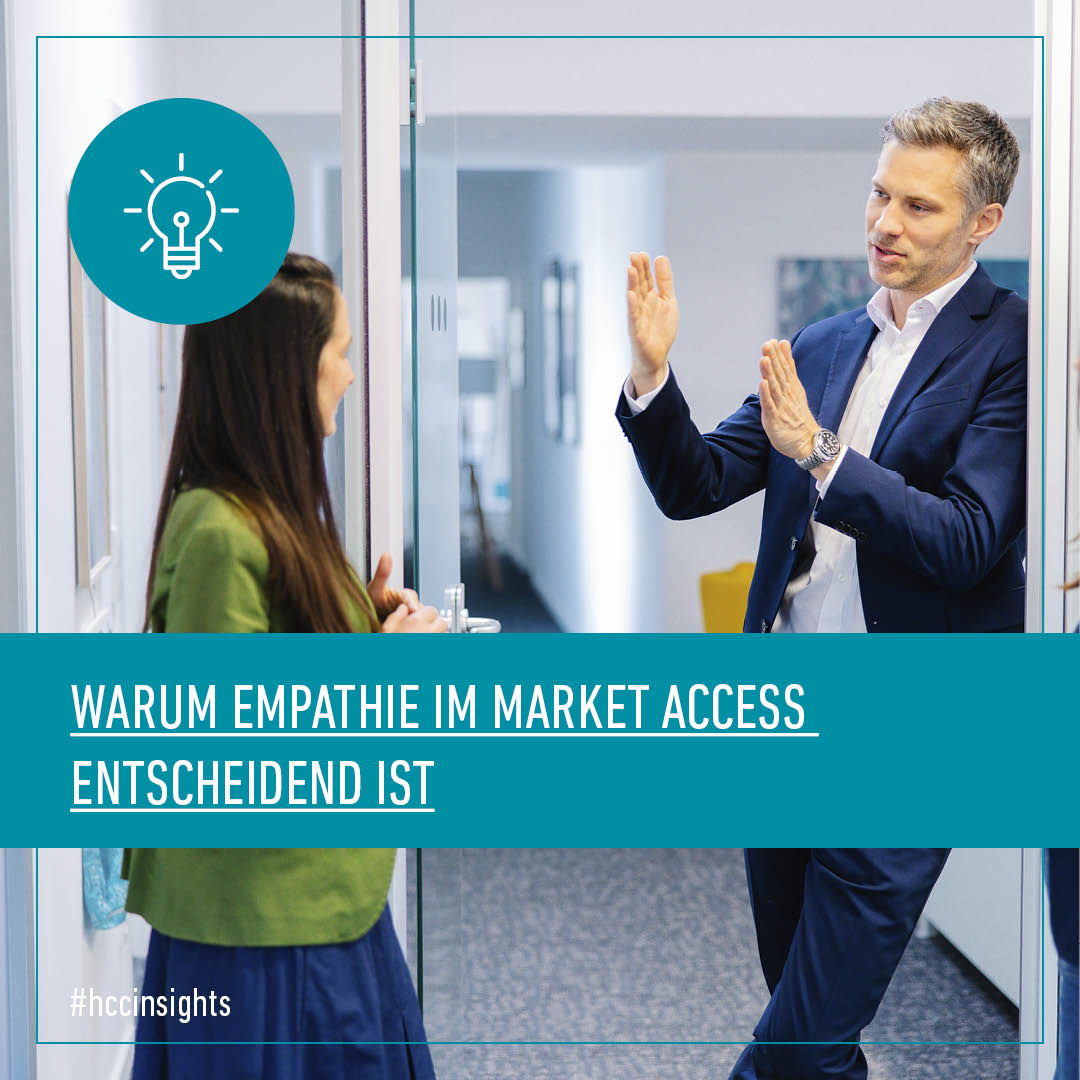In diesem Artikel blicken wir auf ein System, in dem nicht unbedingt der medizinisch beste Weg, sondern oft der zuständigkeitsfreundlichste eingeschlagen wird – mit Auswirkungen auf Versorgungssicherheit, Patientenerlebnis und Innovationszugang.
Zwei Systeme, ein Ziel und ein Strukturproblem
Krankenhäuser und der niedergelassene Bereich sind zwei Welten mit unterschiedlichen Logiken. Während im Spital häufig teure, komplexe Therapien initialisiert werden, ist die Weiterbehandlung im ambulanten / niedergelassenen Setting oft gar nicht vorgesehen – oder nur schwer umzusetzen. Das führt dazu, dass Patient:innen nach Entlassung nicht automatisch nahtlos weiterversorgt werden können.
Ein zentraler Streitpunkt ist dabei die Frage der Erstattung: Wer zahlt für ein Medikament, das im Krankenhaus begonnen wurde, aber zu Hause weitergeführt werden müsste? Früher galt die Faustregel: Was einfach verabreicht werden kann – etwa eine Tablette oder Fertigspritze –, gehört in die Apotheke und damit in den Verantwortungsbereich der Sozialversicherung. Nur besonders komplexe oder sicherheitskritische Behandlungen verblieben im Spital.
Doch diese Systematik beginnt zu erodieren. Zunehmend bleiben auch einfach anzuwendende Medikamente im Spital „verhaftet“ – mit der Begründung, die Erkrankung sei zu komplex oder selten, um sie in den niedergelassenen Bereich zu verlagern. Das ist nicht nur unpraktisch für die Patient:innen, sondern in vielen Fällen auch teurer und ineffizient.

Wenn beide Seiten abwinken – bleiben Patient:innen auf der Strecke
Ein weiteres Problem: Anwenderfreundlichkeit wird nicht belohnt. Pharmazeutische Innovationen führen dazu, dass Therapien zunehmend patientennahe werden – etwa durch subkutane Injektionen oder orale Darreichungsformen. Doch anstatt diese Vorteile zu nutzen, verweigern manche Kostenträger die Erstattung für diese neuen Formen, mit Verweis auf bestehende intravenöse Varianten im Spital.
So entsteht ein unglücklicher Zirkelschluss:
- Das Krankenhaus verweist auf die Fertigspritze für die Selbstanwendung zu Hause.
- Die Kasse lehnt diese ab – und pocht auf die altbekannte IV-Infusion im Spital.
- Und Patient:innen bleiben in der Schwebe – oder fahren regelmäßig ins Krankenhaus, obwohl es nicht nötig wäre.
Das ist keine böse Absicht, sondern Ausdruck einer strukturellen Dysfunktion: Budgetlogiken übersteuern die Versorgungslogik. Gleichzeitig fehlt eine übergeordnete Instanz, die im Sinne der Patient:innen den „Best Point of Care“ festlegt – unabhängig von institutionellen Besitzständen.
Und das hat reale Konsequenzen: für die Patient:innen, die Zeit, Energie und Lebensqualität verlieren, weil sie regelmäßig ins Krankenhaus müssen. Für die Ressourcen, die in Spitälern blockiert werden, obwohl die Behandlung zu Hause möglich wäre. Und nicht zuletzt für die Innovation selbst – die so nur halb ankommt.
Der Versuch einer Lösung: 50:50-Vereinbarungen
In einzelnen Regionen wurden bereits pragmatische Ansätze erprobt: Sogenannte 50:50-Vereinbarungen sehen vor, dass sich Krankenhäuser und Sozialversicherung die Kosten für bestimmte Medikamente teilen – unabhängig davon, wo sie verabreicht werden. Das Modell bricht mit dem alten Prinzip „Wer zahlt, verliert“ und ersetzt es durch einen pragmatischen Ansatz: Was hilft den Patient:innen– und wie kann man es gemeinsam ermöglichen?
Gerade in Flächenbundesländern mit langen Anfahrtswegen ist das mehr als nur eine organisatorische Verbesserung. Wer 70 Kilometer zum nächsten Krankenhaus fahren müsste, um eine Behandlung zu erhalten, die auch zu Hause durchführbar wäre, profitiert massiv von solchen Vereinbarungen. Auch Homecare-Modelle könnten dadurch gestärkt werden.
Ein Wermutstropfen: Derzeit beziehen sich diese Regelungen meist auf intravenöse Therapien. Subkutane oder orale Alternativen – die sich besonders für den niedergelassenen Bereich eignen – bleiben oft weiterhin außen vor.
Was es braucht – und was im Weg steht
Damit solche Schnittstellenmodelle nicht Einzelfälle bleiben, braucht es vor allem drei Dinge:
- Klare Rahmenbedingungen, die Zuständigkeiten nicht gegeneinander ausspielen.
- Vertrauen zwischen den Akteuren, um gemeinsame Lösungen nicht am kleinsten gemeinsamen Nenner scheitern zu lassen.
- Eine konsequente Orientierung am Patientenwohl, nicht an Budgethoheiten.
Doch genau diese Punkte werden in der Praxis oft durchbrochen: Die Fragmentierung der Trägerschaften, historisch gewachsene Strukturen und fehlende Anreize für intersektorale Zusammenarbeit machen ganzheitliche Versorgung schwierig. Dabei zeigen Beispiele aus der Praxis, dass es auch anders geht – wenn Wille und Struktur zusammentreffen.
Fazit: Versorgung braucht Verbindung
An der Schnittstelle zwischen Spital und niedergelassenem Bereich entscheidet sich oft, ob Innovation bei den Patient:innen ankommt. Solange die Zuständigkeitsfrage über die Versorgungsentscheidung dominiert, wird das System seinem Anspruch nicht gerecht. Die gute Nachricht: Es gibt bereits Lösungsansätze. Die Herausforderung liegt nun darin, sie zu verstetigen – und das System dort zu entwirren, wo es seine Patient:innen unnötig im Kreis schickt.
Das könnte Sie auch interessieren: